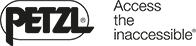Interview mit Lukas Irmler
Lukas Irmler ist Highliner und verbindet seine packenden Projekte mit beeindruckenden Orten. Dabei muss er oft auch anspruchsvolle alpine Aufstiege und Kletterrouten auf sich nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Im Interview verrät er, was ihn antreibt, wie die Zukunft im Slackline-Bereich aussieht und warum man beim Slacklinen ein Flow-Erlebnis hat.
10 Mai 2023
Lukas, als Highliner bist du bei Petzl eher ein Exot. Magst du uns erzählen, was dich zu uns gebracht hat?
Ich bin in der Tat der einzige Slackliner bei Petzl, habe aber eigentlich schon immer Petzl-Gurte benutzt. Als dann Petzl Deutschland gegründet wurde, ist eine Kooperation zustande gekommen. Oft muss ich klettern, um zum Startpunkt meiner Highline zu kommen, und dafür braucht man geeignetes Material. Auch zum Aufbau der Slackline selber nutze ich Petzl-Produkte, oft auch aus dem Industriekletterbereich, beispielsweise für Flaschenzüge. Und so bin ich ins Petzl-Team gekommen. Das war von Anfang an für mich sehr cool, da ich dadurch auch mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die aufgrund ihres Kletter- und Bergsteigerkönnens im Team sind und die für mich schon immer Idole waren. Es ist eine tolle Community, in der ich mich sehr wohl fühle und in der ich auch das Gefühl habe, als Slackliner komplett integriert zu sein. Slacklinen ist ja eigentlich auch aus dem Klettersport entstanden. Und die Art und Weise, wie ich diesen Sport sehe oder betreibe, ist eigentlich auch sehr nahe am Klettern.
© Valentin Rapp
Was motiviert dich bei einem neuen Slackline- oder Highline-Projekt?
Slacklinen ist für mich eine Mischung aus Kunst und Sport, da es hauptsächlich um die Ästhetik der Line geht. Der Idealfall ist, dass du zwei exponierte Türme hast, die du dann mit einer Slackline verbindest und so eine Luftbrücke baust. Oder irgendwelche anderen besonderen Orte, die du mit dieser Line zusammenbringst. Und das Gesamtbild, was dann schlussendlich entsteht ist eigentlich das, was mir extrem wichtig ist. Wenn ich beispielsweise eine Line an einem freistehenden Turm aufbaue, sollte sie auch wirklich ganz oben fixiert sein und nicht irgendwo zwischendrin, da die Ästhetik eine große Rolle spielt. Inzwischen habe ich oft eine andere Herangehensweise für meine Projekte, bei denen das Außenrum eine größere Bedeutung bekommt.
Eine Slackline ist im Grunde genommen immer gleich. Sie fühlt sich zwar mal anders an und ist unterschiedlich zu laufen, aber die großen Unterschiede entstehen durch die Umgebung. Deshalb ist beim Highlinen die entscheidende Frage oft: Wo ist das und wie komme ich da hin? Inzwischen ist der Weg mehr das Ziel als die Slackline selbst, weil die Slacklines kann ich meistens laufen, wenn sie jetzt nicht drei Kilometer lang sind oder 100 kmh Wind gehen. Ein Beispiel hierfür ist meine Slackline in der Gouffre-Berger-Höhle im Jahr 2016, die 500 Meter unter der Erde lag. Ich war vorher noch nie ernsthaft caven und der Zugang war eine große Herausforderung. Man musste erstmal 500 Meter in den Berg hineinklettern und wusste, dass man acht oder neun Stunden brauchte, um wieder rauszukommen. Da unten darf einem auch nichts passieren, schon wenn man sich die Hand bricht, kann das ernste Konsequenzen haben.
Ein weiteres Beispiel ist das Höhenbergsteigen, das ich mit Slacklinen verbunden habe. Ich habe versucht, eine Slackline auf knapp 6000 Meter zu spannen. Bei meinen aktuellen Projekten geht es häufig um die alpine Schwierigkeit von einem bestimmten Berg. Man muss zum Beispiel klettern oder Gletscher überqueren, um an den Ort zu kommen. Der Zugang ist für mich mittlerweile die größere Herausforderung als die Slackline selbst.
© Valentin Rapp
Was sind deiner Meinung nach die Slackline-Herausforderungen der Zukunft?
Das ist schwer zu sagen, da es viele verschiedene Formen gibt, wie man Slacklinen betreiben kann. Das was ich heutzutage viel mache, könnte man zusammenfassen unter dem dem Spektrum von alpinen Highlines oder Expeditions-Slacklines. In dem Bereich gibt es schon ein paar Projekte, in denen ich die zukünftigen Herausforderungen sehe. Beispielsweise die Trangotürme oder ähnliche Berge in Pakistan und im Karakorum, wo man zusätzlich zur Höhe noch bigwall-artige Zustiege hat und im Idealfall noch lange Slacklines spannen kann. Diese drei Komponenten in einer abgelegenen Umgebung wären tolle Herausforderungen, sind aber momentan noch Zukunftsmusik. Das ist eine der Richtungen, in die ich mich entwickeln will, das kann aber sicherlich noch 2,3 Jahre dauern, weil die Anforderungen so komplex und vielseitig sind. Außerdem machen das wirklich nicht viele Leute. Das ist tatsächlich auch eines der größten Probleme, die ich bei diesen Projekten habe - es ist oft wirklich schwer, Partner zu finden, da man so etwas nicht alleine machen kann.
Ansonsten gibt es den Bereich von den längsten Slacklines der Welt, in dem ich die letzten Jahre auch ein bisschen mitgemischt habe. Wir haben einmal eine 2,8 Kilometer lange Line aufgebaut, die wir damals nicht ganz durchlaufen konnten. Inzwischen liegt der Weltrekord bei 2,7 Kilometer. Ich bin mir aber sicher, dass die drei Kilometer irgendwann auch noch geknackt werden. Das ist sicherlich auch ein Zukunftsbereich.
Ein anderer Aspekt des Slacklinen, der relativ weit weg ist vom alpinen Bereich, ist das Freestyle-Highlinen, bei dem es darum geht, Tricks zu machen. Dabei ist man auf ca. 60-70 Meter langen Highlines unterwegs, die relativ straff gespannt sind. Da kann man dann super drauf bouncen und Rotationen einbauen. Diesen Bereich habe ich mit ein paar anderen Leuten zusammen mehr oder weniger mit initiiert. Inzwischen ist es zu einer eigenen Community gewachsen, in der viele neue Leute fast ausschließlich Tricks machen und gar nicht mehr auf Slacklines laufen. Das ist sicher auch ein Bereich des Slacklinens, der sehr zukunftsträchtig ist, da es ein Format ist, das man relativ gut vergleichen kann und was auch für Publikum ein spektakulärer Sport ist.
© Valentin Rapp
Abgesehen vom Zustieg oder denSchwierigkeiten beim Aufbau: Gibt es beim Laufen der Lines irgendwelche Parallelen zum Klettern?
Eine der Parallelen ist, dass man im Grunde genommen dieselbe Grundherausforderung hat, nämlich dass man von einem Punkt zum anderen ohne Sturz laufen möchte. Das ist quasi wie eine Rotpunktbegehung einer Route, bei der man beim Ausbouldern auch mit Unterbrechungen klettert. Bei uns ist es oft so, dass man die Line mit Unterbrechungen läuft und das Ziel ist dann immer, die Line in einem Go durchzulaufen. Es gibt auch ähnliche Terminologien wie beim Klettern. Wir haben zum Beispiel auch das Onsighten übernommen. Das bedeutet bei uns, dass man die Line beim ersten Versuch läuft. Das ist natürlich ein bisschen was zwischen Flash und Onsight, weil es beim Slacklinen keinen großen Unterschied macht, ob ich die Strecke vorher anschaue oder jemand anderem zuschaue.
Gibt es Parallelen in Bezug auf das Mindset oder der Herangehensweise?
Da gibt es meiner Meinung nach eher Unterschiede. Beim Klettern hast du verschiedene Bewegungen,die du aneinanderreihst und verschiedene Schwierigkeitsgrade. Beim Slacklinen ist es so, dass du unterschiedliche Steigungen unter dir hast. Am Anfang geht es steil runter, dann wird es flacher und zum Schluss wird's wieder steiler. Es ändert sich also schon etwas und es ist auch nicht jeder Schritt gleich. Dennoch ist es eine verhältnismäßig monotone Bewegungsform, bei der du leichter in den Flow gerätst als beim Klettern. Durch die ständig gleiche Bewegung denkst du im Idealfall gar nicht mehr darüber nach, was du machst, sondern bist im Kopf komplett frei und lässt den Körper einfach machen. Klar kann man auch sagen, wenn du beim Klettern einen richtig geilen Go hast und eine Route perfekt kletterst, dann denkst du auch nicht mehr über jeden Move nach, sondern dann ist auch alles automatisiert und dein Körper macht was er soll. Das ist schon eine ähnliche Erfahrung. Aber im Vergleich zum Klettern ist das Slacklinen ein bisschen monotoner. Außerdem verbringst du auf der Slackline oft viel mehr Zeit als beim Sportklettern. Eine Route kletterst du normalerweise in 5 bis 6 Minuten, aber für die längeren Lines können es schon mal anderthalb Stunden sein, die du brauchst, um sie zu überqueren. Es gibt zwar auch Routen, bei denen man so lang drin hängt aber das ist eher die Ausnahme.
Man kommt leichter in den Flow als beim Klettern.
Das ist für mich auf jeden Fall so, weil die Bewegung gleichförmiger ist und die Schwierigkeit immer ähnlich ist, wenn die Bedingungen passen. Wenn starker Wind ist, kommst du nicht in den Flow, weil du bei jedem Schritt ordentlich was zu tun hast. Aber wenn es gut läuft, dann ist es relativ monoton. Du stapfst so vor dich hin, ähnlich wie Skitourengehen.
© Valentin Rapp
Lukas, du bist ja auch als Speaker aktiv. Geht es in deinen Talks auch viel um Slackline oder andere Thematiken? Wohin ziehst du Verbindungen?
Im Grunde genommen spreche ich viel darüber, was man aus dem Slacklinen, aber auch aus dem Klettern, Bergsteigen und anderen Sportarten für das normale Leben, das Geschäftsleben oder für seine eigenen Herausforderungen mitnehmen kann. Im Sport, gerade beim Slacklinen, ist es oft visuell verständlich, welche Herausforderungen man hat und wie sie bewältigen kann. Dadurch hat man ein paar sehr schöne Metaphern, mit denen man Botschaften, die nicht zwingend neu sind, aber im Kern wichtig, so attraktiv verpacken kann, dass sich jeder emotional damit verbinden kann. Ein großes Thema sind hier Ängste. Das war bei mir am Anfang beim Slacklinen auch ein Riesenthema. Ängste sind auch nach wie vor beim Highlinen zu einem gewissen Grad bei mir präsent, weil du dieser Höhe und dieser Ausgesetztheit so schutzlos ausgeliefert bist, ohne die Möglichkeit zu haben, mit physischer Kraft dagegen zu arbeiten. Du bist immer in diesem labilen Gleichgewicht und quasi nie zu hundert Prozent stabil. Du bewegst dich immer und musst immer irgendetwas aktiv tun. Außerdem können jederzeit Windböen kommen, die dich aus dem Gleichgewicht werfen. Mit dieser permanenten Unsicherheit in dieser Höhe ausgesetzt zu sein, hat eine ganz andere Wirkung, als in einer 100 oder 200 Meter hohen Wand zu hängen.
Am Anfang war das für mich ziemlich lähmend, aber auch der Ort, an dem ich gelernt habe, wie egal es im Endeffekt ist, wie stark die Angst ist. Du kannst eigentlich jede Angst überwinden lernen, wenn du dich ihr in Dosen aussetzt, die du bewältigen kannst. Es ist wichtig, positive Fortschritte zu machen und sich in ganz kleinen Schritten Kontrolle zu erarbeiten und bewusst zu reflektieren. Angst ist ja oft ein sehr diffuses Gefühl und reicht im Prinzip von Respekt bis zu Panik. Respekt ist das, was wir nie verlieren sollten, weil alles, was wir machen, im Gebirge oder auch auf der Slackline, ist potenziell gefährlich. Wenn man keinen Respekt mehr hat, dann wird man schnell leichtsinnig. Panik ist natürlich das, was wir nie wollen und auch nichts bringt, weil es jedes sinnvolle Handeln beendet. Am Anfang war es totale Panik, was ich gespürt habe und was ich auch zu bewältigen hatte.
Irgendwann konnte ich diese Panik auf ein gesundes Mittelmaß reduzieren und nun auf Respekt beschränken. Durch dieses Bewusstsein und das Wissen, dass ich gesichert bin, kann ich jetzt willentlich über diese Angstgrenze hinausgehen, weil ich weiß, dass die Konsequenz nicht der tödliche Absturz ist. Und das ist das, was ich in meinen Vorträgen vermitteln möchte, weil sich eigentlich die wenigsten Menschen Gedanken darüber machen, ob ihre Ängste gerechtfertigt sind oder einen vernünftigen Grund haben. Wir haben Angst vorm Fliegen, vor Spritzen oder Spinnen.. Wenn man aber drüber nachdenkt, ist Fliegen nicht gefährlich, Spritzen sind meistens hilfreich und Spinnen sind zumindest in unseren Breitengraden nicht giftig. Es gibt also keinen rationalen Grund, vor diesen Sachen Angst zu haben. Ich finde, das dieses Bewusstsein uns viel Sicherheit gibt, wenn wir erkennen, dass die Angst nur in unserem Kopf existiert und nicht in der Realität. Das gitl auch für das Slacklinen, denn hier empfindet man eine Riesenangst.
Worauf freust du dich dieses Jahr besonders?
Ich freue mich besonders darauf, im Juni, Juli und August noch einmal nach Chamonix zu gehen. Vor zwei Jahren hatte ich für das Seven-Summit-Projekt am Montblanc das erste Mal die Gelegenheit, diese Gebirgsregion näher kennenzulernen. Dort entdeckte ich das unendliche Potenzial für wirklich geniale Highlines und außerdem fantastische Gipfel, die alle relativ hoch und anspruchsvoll zu klettern sind. Letzten Sommer waren wir wieder dort, weil ich ein Projekt am Grand Capucin hatte, einem gigantischen Felsturm im Montblanc-Gebiet. Er gilt als der schwerste Normalweg der Alpen, wobei der leichteste Weg zum Gipfel eine 7+ ist, was allein aus Kletteraspekten schon fantastisch ist. Mein Ziel ist es, von diesem Turm eine Highline zu spannen. Es gibt dort auch eine ganz gute Möglichkeit, eine 200 Meter lange Line zu spannen. Wir haben es letztes Jahr bereits versucht, konnten es aber nicht schaffen, weil wir ein bisschen zu wenig Zeit hatten und auch den Aufstieg ein bisschen unterschätzt hatten. Wir waren zwar noch ein zweites Mal auf dem Capucin oben, haben die Highline aber schlussendlich nicht machen können. Hoffentlich klappt das diesen Sommer!
Da drücken wir dir alle die Daumen, dass es diesen Sommer klappt! Vielen Dank für deine Antworten, Lukas!
Verwandte Meldungen